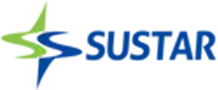Beziehung zwischen Proteinen, Peptiden und Aminosäuren
Proteine: Funktionelle Makromoleküle, die durch die Faltung einer oder mehrerer Polypeptidketten zu spezifischen dreidimensionalen Strukturen über Helices, Faltblätter usw. gebildet werden.
Polypeptidketten: Kettenartige Moleküle, die aus zwei oder mehr Aminosäuren bestehen, die durch Peptidbindungen miteinander verbunden sind.
Aminosäuren: Die grundlegenden Bausteine der Proteine; in der Natur existieren mehr als 20 Arten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Proteine aus Polypeptidketten bestehen, die wiederum aus Aminosäuren zusammengesetzt sind.

Prozess der Eiweißverdauung und -absorption bei Tieren
Orale Vorbehandlung: Die Nahrung wird im Mund durch Kauen mechanisch zerkleinert, wodurch die Oberfläche für die enzymatische Verdauung vergrößert wird. Da der Mund keine Verdauungsenzyme besitzt, wird dieser Schritt als mechanische Verdauung bezeichnet.
Vorläufige Aufspaltung im Magen:
Nachdem die fragmentierten Proteine in den Magen gelangt sind, denaturiert die Magensäure sie und legt so die Peptidbindungen frei. Pepsin spaltet die Proteine dann enzymatisch in große Polypeptidmoleküle, die anschließend in den Dünndarm gelangen.
Verdauung im Dünndarm: Trypsin und Chymotrypsin spalten im Dünndarm die Polypeptide weiter in kleinere Peptide (Dipeptide oder Tripeptide) und Aminosäuren. Diese werden anschließend über Aminosäuretransportsysteme oder das Transportsystem für kleine Peptide in die Darmzellen aufgenommen.
In der Tierernährung verbessern sowohl protein- als auch peptidchelatierte Spurenelemente die Bioverfügbarkeit von Spurenelementen durch Chelatisierung. Sie unterscheiden sich jedoch deutlich in ihren Absorptionsmechanismen, ihrer Stabilität und ihren Anwendungsbereichen. Die folgende Analyse bietet einen Vergleich aus vier Perspektiven: Absorptionsmechanismus, Strukturmerkmale, Anwendungseffekte und geeignete Anwendungsbereiche.
1. Absorptionsmechanismus:
| Vergleichsindikator | Protein-chelatierte Spurenelemente | Kleine Peptid-chelatierte Spurenelemente |
|---|---|---|
| Definition | Chelate nutzen makromolekulare Proteine (z. B. hydrolysiertes Pflanzenprotein, Molkenprotein) als Träger. Metallionen (z. B. Fe²⁺, Zn²⁺) bilden Koordinationsbindungen mit den Carboxyl- (-COOH) und Aminogruppen (-NH₂) von Aminosäureresten. | Es werden kleine Peptide (bestehend aus 2–3 Aminosäuren) als Träger verwendet. Metallionen bilden stabilere fünf- oder sechsgliedrige Chelatringe mit Aminogruppen, Carboxylgruppen und Seitenkettengruppen. |
| Absorptionsweg | Sie müssen im Darm durch Proteasen (z. B. Trypsin) in kleine Peptide oder Aminosäuren gespalten werden, wodurch die chelatisierten Metallionen freigesetzt werden. Diese Ionen gelangen dann über passive Diffusion oder aktiven Transport durch Ionenkanäle (z. B. DMT1-, ZIP/ZnT-Transporter) auf den Darmepithelzellen in den Blutkreislauf. | Kann als intakter Chelatbildner direkt über den Peptidtransporter (PepT1) auf Darmepithelzellen aufgenommen werden. Innerhalb der Zelle werden Metallionen durch intrazelluläre Enzyme freigesetzt. |
| Einschränkungen | Bei unzureichender Aktivität der Verdauungsenzyme (z. B. bei Jungtieren oder unter Stress) ist die Effizienz des Proteinabbaus gering. Dies kann zu einer vorzeitigen Zerstörung der Chelatstruktur führen, wodurch Metallionen an antinutritive Faktoren wie Phytat gebunden werden und ihre Verwertung eingeschränkt wird. | Umgeht die kompetitive Hemmung im Darm (z. B. durch Phytinsäure) und die Absorption ist nicht von der Aktivität von Verdauungsenzymen abhängig. Besonders geeignet für Jungtiere mit noch nicht ausgereiftem Verdauungssystem oder kranke/geschwächte Tiere. |
2. Strukturelle Eigenschaften und Stabilität:
| Merkmal | Protein-chelatierte Spurenelemente | Kleine Peptid-chelatierte Spurenelemente |
|---|---|---|
| Molekulargewicht | Groß (5.000–20.000 Da) | Klein (200~500 Da) |
| Chelatbindungsstärke | Mehrere Koordinationsbindungen, aber eine komplexe Molekülkonformation führen im Allgemeinen zu mäßiger Stabilität. | Eine einfache, kurze Peptidkonformation ermöglicht die Bildung stabilerer Ringstrukturen. |
| Störungsresistenz | Ist anfällig für Einflüsse durch Magensäure und Schwankungen des pH-Werts im Darm. | Stärkere Säure- und Laugenbeständigkeit; höhere Stabilität im Darmmilieu. |
3. Anwendungseffekte:
| Indikator | Proteinchelate | Kleine Peptidchelate |
|---|---|---|
| Bioverfügbarkeit | Abhängig von der Aktivität der Verdauungsenzyme. Wirksam bei gesunden, ausgewachsenen Tieren, aber die Wirksamkeit nimmt bei jungen oder gestressten Tieren deutlich ab. | Aufgrund des direkten Absorptionswegs und der stabilen Struktur ist die Bioverfügbarkeit von Spurenelementen 10 bis 30 % höher als die von Proteinchelaten. |
| Funktionale Erweiterbarkeit | Relativ schwache Funktionalität, dienen hauptsächlich als Spurenelementträger. | Kleine Peptide besitzen selbst Funktionen wie Immunregulation und antioxidative Aktivität und bieten stärkere Synergieeffekte mit Spurenelementen (z. B. bietet das Selenomethionin-Peptid sowohl Selen-Supplementierung als auch antioxidative Funktionen). |
4. Geeignete Szenarien und wirtschaftliche Überlegungen:
| Indikator | Protein-chelatierte Spurenelemente | Kleine Peptid-chelatierte Spurenelemente |
|---|---|---|
| Geeignete Tiere | Gesunde ausgewachsene Tiere (z. B. Mastschweine, Legehennen) | Jungtiere, gestresste Tiere, ertragreiche Wasserarten |
| Kosten | Niedriger (Rohstoffe leicht verfügbar, einfacher Prozess) | Höher (hohe Kosten für die Synthese und Reinigung kleiner Peptide) |
| Umweltauswirkungen | Nicht resorbierte Bestandteile können mit dem Stuhl ausgeschieden werden und so potenziell die Umwelt belasten. | Hohe Auslastung, geringeres Risiko der Umweltverschmutzung. |
Zusammenfassung:
(1) Bei Tieren mit hohem Spurenelementbedarf und schwacher Verdauungsfähigkeit (z. B. Ferkel, Küken, Garnelenlarven) oder bei Tieren, die eine schnelle Korrektur von Mängeln benötigen, werden kleine Peptidchelate als Mittel der Wahl empfohlen.
(2) Für kostensensible Tiergruppen mit normaler Verdauungsfunktion (z. B. Nutztiere und Geflügel in der Endmastphase) können protein-chelatierte Spurenelemente ausgewählt werden.
Veröffentlichungsdatum: 14. November 2025